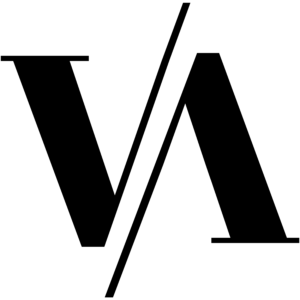Der Textanfang.
„Um einen guten Liebesbrief zu schreiben, musst du anfangen, ohne zu wissen, was du sagen willst, und endigen, ohne zu wissen, was du gesagt hast.“ Jean-Jacques Rousseau hat mit diesem Zitat offensichtlich einen romantischen Anschlag auf das Briefschreiben ausgeübt – und spricht damit Wesentliches eines Schreiballtags an.
Zum einen ist das Schreiben für viele etwas sehr Romantisches. Allein die Vorstellung, Tag um Tag Denkarbeit zu Papier zu bringen, ist für Außenstehende etwas Gefühlvolles, ein Mysterium, gar exotisch. Die erstaunten Gesichter, die mir nach der Beantwortung der Frage: „Und was machst du beruflich?“, so begegnen, sind jene Zeugen, die Schriftsteller als ein besonderes Grüppchen berufstätiger Menschen identifizieren. So romantisch wie es auf den ersten Blick scheint, Gedanken, Gefühle, Ansichten, Meinungen, sterile Fakten oder Vergangenes schwarz auf weiß zu verewigen, so nüchtern und hart ist es zugleich.
Hart, weil es harte Arbeit ist. Texte werden nicht im Kopf gedacht und anschließend runtergetippt. Sie werden erst im Schreiben selbst geschaffen. Auch damit hatte Rousseau also recht: Man kann nicht zu Ende denken, was sich im Prozess selbst erschafft. Und deshalb bin ich – ganz ehrlich – an so vielen Texten und an so vielen Tagen und Nächten, die voll von Schreibarbeit sein sollten, gescheitert. Ich wollte es durchdenken, ich wollte wissen, was als Nächstes kommt, was das nächste Wort sein muss, welcher Gedanke sich stimmig an den nächsten schmiegt. Womit anfangen? Und womit enden? Das Wichtigste, was es mehr denn je zu lernen gilt, ist das Immer-wieder-Anfangen. Hinsetzen. Lostippen. Und dabei nicht vergessen, Herz, Kopf und Bauch angeschaltet zu lassen. Sich nicht verlieren, in den schier unendlichen Möglichkeiten des Textens. Planlos fokussiert bleiben. Fasziniert auf das Ende hinarbeiten. Und sich dem eigenen Perfektionismus mutig entgegenstellen.
Einen dritten Aspekt birgt dieses Zitat ebenfalls. Es ist der Aspekt des Rausches, bei dem du dich am Ende nicht mehr an seinen Anfang erinnern kannst. Schreiben beschwingt, setzt dich auf Drogen, wird zum verrücktesten, süchtigmachenden Trip deines Tages. Vielleicht deiner Woche. Etwas zu veröffentlichen, erregt, setzt unter Spannung und macht im gleichen Moment unsicher. Wie kommt es an? Kommt es überhaupt an? Wieder zeigt sich hier, wie hart Texten ist. Ich quäle mich als Texterin nicht nur mit Schreibblockkaden, Recherchen, Rechtschreibung und dem gegenwärtig verbreiteten Schrei nach Aktualität. Ich quäle mich auch immer wieder mit der Angst vor Ablehnung. Einer sehr persönlichen Ablehnung, denn alles, was ich als Autor veröffentliche, lässt den Leser ein Stück weit ein in meine Welt. Manchmal ist es Prosa. Manchmal dokumentarisch. Manchmal über andere. Manchmal über mich. Manchmal beides. Manchmal erfunden. Aber immer irgendwie persönlich. Immer ein Blick durch meinen Filter auf die Welt.
Diese Angst, ich muss sie loslassen. Mich freimachen. Freischreiben. Denn nicht jeder wird mögen, was ich ihm in 26 Buchstaben serviere. Nicht allen wird es schmecken. Zu würzig, zu fad, verkocht oder trocken. Das ist okay. Ich werde diejenigen finden, denen ich neben Vorspeise und Hauptgang auch noch das Dessert servieren darf. Jedoch muss ich anfangen. Mut gewinnen. Mut für das Bewusstsein meiner selbst als Texterin und Mut für wirklich, wirklich gute Texte. Bei denen ich am Ende, mit einem Lächeln im Gesicht nicht genug vom Immer-wieder-Durchlesen bekomme. Bei denen es mir egal ist, wie sie wohl ankommen mögen, weil sie gut sind. Gut für mich. Und gut für die Geschichte, die ich erzählen will.
Deshalb ist das hier mein Anfang. Ein Neuanfang. Ein Textanfang. Ein Überhauptanfang. Mit dir. Meiner großen Liebe des Schreibens.